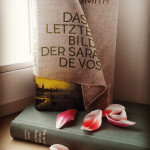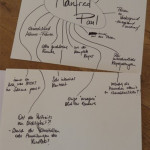EINE VERMITTLUNGSSITUATION VON JULIA SCHMIDT, ANJA WEBER UND ANNA SCHADE
Verortung
„Ein Museum ist eine gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit
zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft
und ihrer Entwicklung, die zu Studien- und Bildungszwecken,
zu Freude, Spaß und Genuss materielle Zeugnisse von
Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht,
bekannt macht und ausstellt.”
ICOM-Definition des Begriffs „Museum“ aus dem Code of Ethics for Museums 2003
Die Vergangenheit hinterlässt Zeugnisse, die gesammelt und für die Zukunft aufbewahrt werden müssen, um der Gegenwart eine Orientierungsmöglichkeit zu bieten. Ein Museum bietet diesen Wissensspeicher. Es ermöglicht das Erleben “authentischer Objekte” und die unmittelbare Konfrontation mit Originalen. Viele RezipientenInnen erleben diese Erfahrung sinnlicher und intensiver als die Begegnung mit Reproduktionen. Daraus resultierend steigt die persönliche Identifikation mit dem Museumsobjekt und die Motivation Hintergrundwissen zu erwerben.
Das Museum ist im Fach Kunst der zentrale außerschulische Kulturpartner, der für SchülerInnen und LehrerInnen neue Formen des Lehrens und Lernens befördert (Rupprecht 2016, S.267). Somit der optimale Ort, um eine “Ding- oder Bildkompetenz” jenseits der Fachdisziplinen zu erwerben, die zu einem sinnstiftenden Umgang mit den materiellen Überresten von Kultur befähigen. Diese umfasst die Fähigkeit, sich Objekten und Bildern in ihrem jeweiligen Kontext adäquat anzunähern und selbst Bedeutungen und Bilder zu generieren. Der Lernende nimmt während einer meist gemeinsamen und problemorientierten Bearbeitung relevanter und authentischer Aufgaben im konkreten Handlungskontext eine aktive Rolle ein (Rupprecht 2016, S.268 f.). “Weiter gefasst geht es darum, Kindern und Jugendlichen ‘Museumskompetenz’ zu vermitteln, das heißt, sie zu einem selbstbewussten und kritischen Umgang mit Museen als Orten des lebenslangen Lernens zu befähigen.” (Rupprecht 2016, S.269) MANFRED PAUL IM LEONARDIMUSEUM DRESDEN weiterlesen →